Schattenkraft
*
Hinter einem
guten Willen
findet sich
manchmal im Stillen
eine starke
Schattenkraft,
die verborgen
Unheil schafft.
Gut gemeint, muss
man verstehen,
neigt dazu,
zu übersehen,
dass, wenn man
den Freund belehrt
über Richtig
und Verkehrt,
nicht erkennt,
dass man betrügt,
indem man sich
selbst belügt.
Rein erscheint,
was man bekundet,
einem selbst
vorzüglich mundet.
Weil man Fehler
andrer rügt,
glaubt man, dass
man selbst genügt -
merkt nicht, wie im
eignen Streben
blinde Flecken
Lügen weben.
So wirkt oft im
frommen Streben
ein uns nicht
bewusstes Leben,
das, von uns
dorthin verbannt,
heimlich lenkt
mit dunkler Hand.
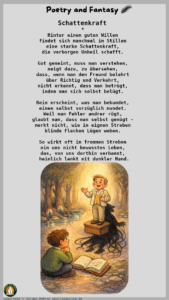
|

