Ein Gedicht steht
auf dem Mond
*
Auf dem Mond,
im weißen Licht,
steht nachdenklich
ein Gedicht.
"Ich und dieser
Erdtrabant
sind vertraut
und wohlbekannt.
Und, bei meiner
Dichterehre,
er bewegt die
Weltenmeere
dieser Kugel,
weiß und blau.
Wenn ich auf
die Erde schau,
seh' ich hinter
ihr im All
leuchtend einen
Feuerball,
um den beide
Kugeln kreisen."
flüstert es in
stillen, leisen
fast bewundernden
Gedanken,
um die
Schöpfungsmacht
zu preisen.
"Dafür will ich
mich bedanken!"
Welche Frau und
welcher Mann
hat dies große
Werk kreiert
und das Regelwerk
studiert,
das den Kosmos
hegt und pflegt?
Von dem Anblick
tief bewegt
fängt die Dichtung
an zu träumen
von den unerforschten
Räumen
dieser wunderbaren
Welt,
die uns in
den Armen hält.
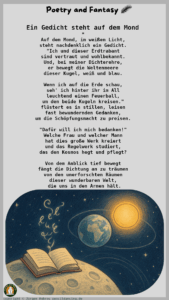
Ein Gedicht auf dem Mond –
Staunen als Anfang des Denkens:
Ein Gedicht steht auf dem
Mond. Von dort blickt es auf
Erde und Sonne und beginnt
zu fragen: Wer hat diese
Ordnung geschaffen, die
Meere und Bahnen lenkt? Damit
wird Sprache selbst zur
Himmelserscheinung:
Sie schaut, denkt, staunt.
Der Mond ist Schwelle und
Spiegel. Von ihm aus wirkt
die Erde vertraut und zugleich
entrückt. So erinnert das
Gedicht daran, dass auch wir
Menschen immer beides sind –
Teil der Welt und Betrachter
von außen. Im Zentrum aber
steht das Staunen.
Seit den frühen Philosophen
gilt es als Ursprung allen
Denkens. Hier erscheint es
nicht in gelehrten Begriffen,
sondern in einem schlichten
Satz: „Dafür will ich mich
bedanken.“ Kein dogmatisches
Wissen, sondern ein leises
Anerkennen. Am Ende beginnt
die Dichtung zu träumen.
Von Räumen, die unerforscht
bleiben, und von einer Welt,
die uns hält wie in Armen.
So lädt das Gedicht dazu ein,
das Staunen nicht zu verlernen –
als philosophische
Grundhaltung, als poetisches
Geschenk.
|

